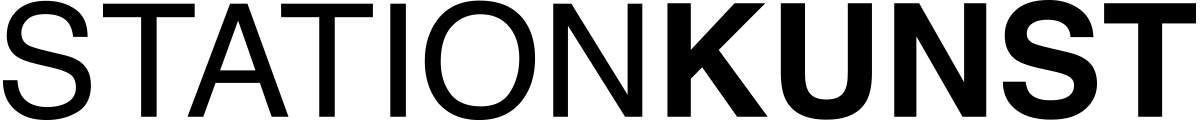Eugen Kunkel
Warum malst du eigentlich?
Mit dieser Frage wurde ich häufiger konfrontiert in meinem Studium. Ich studierte 2002-2007 Malerei bei Prof. Peter Redeker, der bei uns an der FH Hannover eigentlich freie Grafik unterrichtete. Aber bei uns in der Klasse saßen alle möglichen Leute, die mit Grafik weniger bis gar nichts zu tun hatten, sondern malten, bildhauerten, fotografierten, filmten oder sonst was machten, was man vage als Kunst umschreiben könnte. Der allgemein freie Geist, der in dieser Klasse herrschte und die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die woanders bei den Profs nur leichtes Naserümpfen oder hochgezogene Augenbrauen hervorgerufen hätten, zogen einen besonderen Schlag von Menschen an, mit denen man wunderbar über Kunst oder sonst alles mögliche diskutieren oder streiten konnte. Außerdem gab es immer Kaffee und Kekse. Einmal bei einem unserer wöchentlichen Treffen war die Keksdose leer, also stand Redeker auf, setzte sich in sein Auto, fuhr zum nächsten Supermarkt und kaufte neue. Ein Professor, der für seine Studenten Kekse holt, wer hatte so was schon? Hört sich also nach einem bombastischen Studium an. Aber diese eine Frage: „Warum malst du eigentlich?“, die vermutlich so in keiner reinen Malerei-Klasse aufgekommen wäre, stand halt immer wieder im Raum und musste beantwortet werden.
Über die Frage, warum ich male, kam ich irgendwann mal zu der Frage, was ich überhaupt malen soll? Das war die eigentlich interessantere Frage, der ich mich bis dato noch nicht gestellt habe, weil ich einfach nur das malte, was mir gerade in den Sinn kam. Ich war mir sicher, dass die Antwort auf diese Frage die Frage, warum ich eigentlich male, mit beantworten würde. Und dann würde mein Tun endlich die Sinnhaftigkeit erhalten, die auch der Arbeit eines Brötchenbäckers innewohnt und sämtliche Fragen nach deren Sinn und Zweck obsolet macht. Kurz gesagt, ich brauchte ein Thema.
Die erste Idee, in welche Richtung es gehen könnte, lieferte ein Buch über den amerikanischen Fotorealismus, das ich in unserer Hochschulbibliothek entdeckte und mir bestimmt ein halbes dutzend mal auslieh. Da hat sich ein Herausgeber die Mühe gemacht, sämtliche amerikanischen Fotorealisten zusammenzubringen, die zu dem Zeitpunkt im Land Rang und Namen hatten, auch solche, die ich noch nicht kannte. Ich sah lauter perfekt abgemalte Fastfoodbuden, metallisch glänzende Wohnmobile, neue Autos in Autohäusern, alte Autos auf dem Schrottplatz, menschenleere Vorstadtsiedlungen mit vor den Häusern parkenden Cadillacs, sich in Schaufenstern spiegelnde Großstadtansichten und amerikanische Mittelklassefamilien, die gerade mit Eisessen beschäftigt waren. Mich faszinierten diese Bilder und die Möglichkeit, einfach solche banalen, alltäglichen Motive zu malen. Die Fotos, die als Vorlagen dazu dienten, hätten mich vermutlich überhaupt nicht interessiert, aber so in mühevoller Feinarbeit auf 200 x 300 cm große Leinwände gebannt, bekamen sie eine Wahrhaftigkeit, die dem abgebildeten Sujet etwas Zeitloses und Allgemeingültiges zu verleihen schien. Es war dann auf einmal nicht irgendein silbern in der Sonne schimmernder Wohnwagen, sondern der Wohnwagen schlechthin, der mir was über den amerikanischen „Way of Life“ erzählte. Das bildete ich mir jedenfalls ein.
Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits fast ein Dutzend Skizzenbücher mit Skizzen aus dem Großstadtleben gefüllt, sie haben zwar mein Auge geschult, aber der Versuch, sie für meine Malerei zu verwenden, scheiterte. Die so entstandenen Bilder hatten etwas „Neusachliches“ an sich und atmeten den Geist der Zwanziger Jahre. Ich brauchte irgendein modernes Medium, das ich zwischen mich und die Realität schalten konnte und kaufte mir 2004 eine kleine Digitalkamera. Nun hatte ich das perfekte Werkzeug, um „Skizzen“ für meine Bilder zu machen. Davon machte ich eine ganze Menge und malte Bilder von Menschen, die irgendwo auf irgendwelchen Treppen saßen, Milchkaffee tranken, mit ihrem Handy spielten oder auf Partys abhingen. Es waren moderne Szenen von modernen Menschen, die wie aus dem Leben gegriffen waren, aber etwas fehlte ihnen, was ich mir zunächst nicht erklären konnte. Wenn ich eine amerikanische Mittelklassefamilie von Robert Bechtle in der Eisdiele Eis essen sah, dann war das irgendwie seine Familie, seine Eisdiele und sein Amerika, das er da malte. Ich kam mir aber vor wie ein beiläufiger Passant, der zufällige Momente aus dem Leben Anderer herausgriff und sie zu seinen zu machen versuchte. Es waren Augenblicke, die überall und nirgendwo stattfinden konnten, aber eben nicht mussten. Es gab keine unbedingte Notwendigkeit für diese Bilder. Das war das Problem. Diese Erkenntnis dämmerte mir, als ich bereits meine Diplomarbeit zum Thema „Portraits“, bei dem ich mir unbekannte Großstadtgesichter porträtieren wollte, angemeldet hatte.
Damals, im März 2006, fuhr ich mit meiner zukünftigen Frau und ihrer Familie zum ersten Mal in den Urlaub auf die dänische Nordseeinsel Fanoe. Ich nahm meine Kamera mit ohne eine besondere Absicht, denn Motive für mein Diplomthema hoffte ich dort nicht zu finden. Stattdessen fand ich eine Natur vor, die mich seltsamerweise an meine Heimat erinnerte, vermutlich weil sie Anfang März dort so ähnlich karg, unwirtlich und reduziert aussah. Ich machte viele Fotos und beschloss, wieder daheim in meinem Hochschulatelier, statt vieler Portraits eine großformatige Landschaft zu malen.
Ein Jahr später zog ich mit meiner Frau nach Greifswald und fand mich mitten in der vorpommerschen Pampa wieder, wo ich nun endgültig von meinen Großstadtthemen abgeschnitten war und mich völlig neu orientieren musste. Ich nahm meine Kamera und ging raus in die Natur. Nun suchte ich mehr oder weniger gezielt nach Motiven, die mich an meine alte Heimat hinter dem Ural erinnerten. Ich streifte in den winterlich gefrorenen Sümpfen am Peeneufer und in den Wäldern zwischen Greifswald, Wolgast und Anklam und machte Fotos. Wie eine Folie legte ich die Bilder aus meiner Erinnerung darüber und fand endlich das, was ich suchte. Ich dachte, du musst es wie Tarkowski in seinem autobiografisch gefärbten Film „Der Spiegel“ machen. Diese Szenen, wo der Mann mit dem Aktenkoffer über’s Feld geht und dann kommt plötzlich ein Windstoß, der über das Gras weht und die Frau, die ihm hinterher schaut, oder die Oma, die mit ihren Enkeln am Waldrand läuft. Das sind die Bilder, die dir im Gedächtnis geblieben sind, weil sie vorher schon da waren, weil das genauso auch deine Erinnerungen gewesen sein könnten, und gleichzeitig waren es die Bilder von den alten Holländern oder Caspar David Friedrich, die schon vor Jahrhunderten gemalt wurden. Nun hatte ich endlich mein Thema, an dem ich mich abarbeiten konnte. Und die Frage, warum ich eigentlich male, erübrigte sich. Denn wenn man einen Ofen hat, muss man Holz dafür hacken. Nur wenn man keinen Ofen hat, müsste man sich fragen, warum man Holz hacken sollte.
www.eugen-kunkel.de